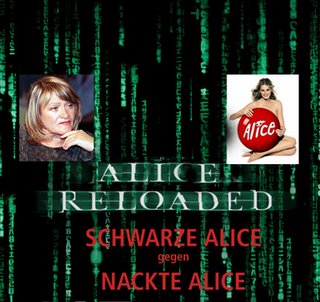Altar neuzeitlicher Alltagssorgen
 Meine groupie-hafte Anbetung der subversiven Tätigkeiten der Berliner Zentralen Intelligenz Agentur (ZIA) und der sich personell überlappenden Riesenmaschine dürfte einigen nicht entgangen sein. Nun sind die Agenten und Riesenmaschinistinnen selbst ins Priester- und Anbetungsbusiness eingestiegen. Ihr soeben am Poetenfest Erlangen vorgestellter Altar bietet mit einem umfassenden Götterpantheon endlich eine polytheistische Fülle in der klaffenden spirituellen Leere alltäglicher Sorgen, mit denen besonders urbane Menschen der Neuzeit allein gelassen werden.
Meine groupie-hafte Anbetung der subversiven Tätigkeiten der Berliner Zentralen Intelligenz Agentur (ZIA) und der sich personell überlappenden Riesenmaschine dürfte einigen nicht entgangen sein. Nun sind die Agenten und Riesenmaschinistinnen selbst ins Priester- und Anbetungsbusiness eingestiegen. Ihr soeben am Poetenfest Erlangen vorgestellter Altar bietet mit einem umfassenden Götterpantheon endlich eine polytheistische Fülle in der klaffenden spirituellen Leere alltäglicher Sorgen, mit denen besonders urbane Menschen der Neuzeit allein gelassen werden.Persönlich bin ich sehr erleichtert, dass es jetzt nicht mehr bloss weltliche ZIA-Gottheiten der satirisch-tiefgründigen Textproduktion, absurder kultureller Unterhaltungsformate und Neuer Medien-Kunst anzuhimmeln gibt, sondern zusätzlich auch ein Altar für scheinbar banale Probleme wie z.B. die menschliche Kopfbedeckung bereitgestellt wurde.
 Den „Gott der Kontrolle über die eigenen Haare“ habe ich bereits angefleht, in Zukunft bitte nicht nur Haarseifen in Supermärkte zu zaubern, die dafür sorgen, Menschen mit Wünschen nach mehr haarigem Volumen zufriedenzustellen, sondern auch seifige Gegenmittel für Häupter, die mit Haarsträhnen allzu üppig ausgestattet sind. Zudem wünschte ich mir jährlich drei Haarjoker, mit denen man an besonders wichtigen Tagen eine unliebsame Frisur neutralisieren kann. Falls meine Wünsche in Erfüllung gehen, habe ich versprochen, auch nie wieder die abgelutschte Wendung „bad hair day“ zu benützen.
Den „Gott der Kontrolle über die eigenen Haare“ habe ich bereits angefleht, in Zukunft bitte nicht nur Haarseifen in Supermärkte zu zaubern, die dafür sorgen, Menschen mit Wünschen nach mehr haarigem Volumen zufriedenzustellen, sondern auch seifige Gegenmittel für Häupter, die mit Haarsträhnen allzu üppig ausgestattet sind. Zudem wünschte ich mir jährlich drei Haarjoker, mit denen man an besonders wichtigen Tagen eine unliebsame Frisur neutralisieren kann. Falls meine Wünsche in Erfüllung gehen, habe ich versprochen, auch nie wieder die abgelutschte Wendung „bad hair day“ zu benützen.Der Riesenmaschine-Altar beherbergt auch den „Gott der vergessenen Passwörter und der gnädigen Amnesie“. Wer zu diesem zwiespältigen Gott des Vergessens und des Ent-Lernens betet, kann darauf hoffen, dass endlich bloss die unwichtigen Informationen dem Verdrängungsmechanismus zum Opfer fallen. Der „Gott der unterhaltsamen Ereignislosigkeit“ ist Schutzpatron aller Blogger, die eigentlich nichts zu sagen haben, aber immerhin das Nichts sprachlich schön verpacken. Vielleicht erbarmt sich ja irgendwann eine Göttin der Bloggerinnen und der notorisch-nervig auf einer möglichst geschlechtergerechten Sprache Beharrenden.
Der „Gott der zu spät gehabten Idee“ ist zuständig für schlagfertige Antworten, die einem erst Stunden später einfallen. Leider wurde dieser Gott aber auf Grund eines zu späten Einfalls erst nachträglich hinzugefügt, und deshalb wird bei vollbrachtem Gebet zu dieser Gottheit auch keine Lampe aufleuchten. Alle anderen Götter mögen den Anbetenden nicht unbedingt zur Erleuchtung verhelfen, werden aber – dem Pantheon der Technikgötter sei Dank! - tatsächlich bei Erhalt des Gebets am Originalaltar selbst erleuchtet.
Amen!